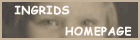Watermelone Man...
oder wie ich lernte, die Melone zu hassen
Dieser elende Ohrwurm, ich krieg' ihn einfach nicht aus meinem Kopf! Und das Bild der riesigen Melone auch nicht. Dabei fing alles ganz harmlos an:
„Ich fahr' für eine Woche nach Holland“, teilte meine Schwester mir mit – sie wohnt im gleichen Haus wie ich. Und als Abschiedsgeschenk von ihr fand ich am nächsten Tag eine riesige Melone vor meiner Türe, mit einem Zettel darauf: „Lasst sie euch gut schmecken!“
Wie nett von ihr, und Wahnsinn, so eine riesige Melone hatte ich noch nie gesehen – sie war einfach überwältigend! Nur wo unterbringen? Den Kühlschrank samt Zwischenböden ausräumen? Auch dann hätte sie nicht hineingepasst. Also in die kühle Waschküche, ja wirklich, wir nennen eine altmodische Waschküche unser eigen, okay, es ist eher eine modrige feuchte Gruft... Ich nahm also die Sackkarre und hievte die Melone in die Gruft... äääh Waschküche, um sie etwas zu kühlen. Die Melone natürlich und nicht die Waschküche.
Der Transport schien mich zu beschwingen, denn schon in der Waschküche hörte ich diese Melodie im Kopf. Ein Stück von Herbie Hancock war es, nämlich 'Watermelone Man'... Ich musste lachen, früher hatte ich immer gedacht, es hieße 'WHAT A MELLOW MAN'... Aber 'Watermelone Man' passte viel besser!
Leider war immer noch was vom ersten Viertel übrig. Die Kollegen verspürten keinen Hunger mehr auf Melone, meine Freunde winkten ab... Was blieb mir also übrig? Kurzentschlossen verteilte ich die Melonenstücke in der hintersten Ecke des Gartens auf einem Stück Brachland, wo eh nix wuchs. Aber vielleicht würde ja die gewaltige Düngung durch die Melone einen Wachstumsschub bewirken.
Und immer noch hörte ich es im Geiste: 'Watermelone Man'... Aber es klang mittlerweile ein wenig lästig.
Zwei Tage später nahmen wir das zweite Viertel in Angriff. Irgendwie war uns ein bisschen die Lust auf Melone vergangen, und wir pickten uns nur die süßen Innenstücke heraus, den Rest warf ich unauffällig beim Spazierengehen in die Gegend. Ich brauchte zehn Spaziergänge dazu, und mich zwackte dabei ein ziemlich schlechtes Gewissen. Man wirft doch keine Lebensmittel weg, das hat mir meine Schwiegermutter eingebläut. Klar doch, die isst alles, auch wenn es schon halb vergammelt ist. Aber ICH NICHT!
Gut, die Hälfte war gegessen, beziehungsweise entsorgt. Ich wuchtete die übrig gebliebene Hälfte der Melone von der Waschküche auf meine Terrasse. Meine Schwester würde nämlich bald wieder da sein, und in der Waschküche hätte sie die verflixte Melone sehen können.
Ich versteckte sie auf der Terrasse unter alten Zeitungen. Sie sah in ihrem Müllbeutel immer noch prächtig aus, ihr zartrotes Fruchtfleisch wirkte immer noch sehr, na ja zartrot...
Ab und zu beim Abstauben schaute ich sie vorsichtig an. Und sie schaute vorwurfsvoll zurück. „Warum isst du mich nicht?“, schien sie zu fragen, jedenfalls bildete ich mir das ein. Und in meinem Kopf ertönte unangenehm das Stück 'Watermelone Man'.
Was sollte ich nur tun? Wegschmeißen konnte ich sie nicht, die Mülltonne wäre unter ihrem Gewicht glatt zusammengebrochen, und Garten und Gegend waren ja auch schon melonengesättigt. Also wartete ich... Aber auf was? Meine Schwester war mittlerweile wieder zu Hause, doch seltsamerweise fragte sie nicht, ob die Melone mir gemundet hätte.
Wirklich seltsam... Und dann kam’s mir. Ich erinnerte ich mich daran, dass ich die Melone schon bei ihr gesehen hatte, die musste uralt sein, älter als Methusalem. Klar doch, Schwesterherz hatte mich reingelegt, sie schmeißt nämlich auch nicht gerne was weg.
Das verdammte Stück 'Watermelone Man' dröhnte in meinem Kopf...
Ich verdrängte die Melone aus meinen Gedanken, nur durch Zufall warf ich ihr heute Morgen einen verlegenen Blick zu, und was soll ich sagen: Sie war im Begriff, sich aufzulösen. Das Fruchtfleisch fing an zu wässern und vergammelte anscheinend. Das war die Gelegenheit! Ich ergriff todesmutig den triefenden Riesenabfallbeutel, schleppte ihn vorsichtig ins Badezimmer und hielt ihn über die Kloschüssel. Dort wrang ich den Beutel regelrecht aus, während ich mir die Nase zuhielt, denn das Zeug stank wie die Pest. Nachdem der Saft ins Klo abgegangen war, konnte ich den Rest endlich in die Mülltonne entsorgen.
Triumphierend erklang die Melodie, aber ich hatte den Text ein wenig abgewandelt, nämlich zu seiner ursprünglichen Form, nämlich: 'WHAT A MELLOW MAN'. Das passte viel besser!
Als ich von der Mülltonne ins Haus zurückkehrte, traf ich meine Schwester. Gut gelaunt sagte sie zu mir: „Du magst doch Wassermelonen, Schatzi! Ich hab’ da noch eine liegen, und da ich morgen in Urlaub fahre...“
ENDE
PS: Danke Herbie Hancock!
PS: Danke Schwesterchen, ich muss oft an dich denken, eigentlich immer, du warst der beste Teil von mir. Und als ich das geschrieben habe, da warst du noch so lebendig, und ich möchte dich lebendig erhalten!
Dieser elende Ohrwurm, ich krieg' ihn einfach nicht aus meinem Kopf! Und das Bild der riesigen Melone auch nicht. Dabei fing alles ganz harmlos an:
„Ich fahr' für eine Woche nach Holland“, teilte meine Schwester mir mit – sie wohnt im gleichen Haus wie ich. Und als Abschiedsgeschenk von ihr fand ich am nächsten Tag eine riesige Melone vor meiner Türe, mit einem Zettel darauf: „Lasst sie euch gut schmecken!“
Wie nett von ihr, und Wahnsinn, so eine riesige Melone hatte ich noch nie gesehen – sie war einfach überwältigend! Nur wo unterbringen? Den Kühlschrank samt Zwischenböden ausräumen? Auch dann hätte sie nicht hineingepasst. Also in die kühle Waschküche, ja wirklich, wir nennen eine altmodische Waschküche unser eigen, okay, es ist eher eine modrige feuchte Gruft... Ich nahm also die Sackkarre und hievte die Melone in die Gruft... äääh Waschküche, um sie etwas zu kühlen. Die Melone natürlich und nicht die Waschküche.
Der Transport schien mich zu beschwingen, denn schon in der Waschküche hörte ich diese Melodie im Kopf. Ein Stück von Herbie Hancock war es, nämlich 'Watermelone Man'... Ich musste lachen, früher hatte ich immer gedacht, es hieße 'WHAT A MELLOW MAN'... Aber 'Watermelone Man' passte viel besser!
Leider war immer noch was vom ersten Viertel übrig. Die Kollegen verspürten keinen Hunger mehr auf Melone, meine Freunde winkten ab... Was blieb mir also übrig? Kurzentschlossen verteilte ich die Melonenstücke in der hintersten Ecke des Gartens auf einem Stück Brachland, wo eh nix wuchs. Aber vielleicht würde ja die gewaltige Düngung durch die Melone einen Wachstumsschub bewirken.
Und immer noch hörte ich es im Geiste: 'Watermelone Man'... Aber es klang mittlerweile ein wenig lästig.
Zwei Tage später nahmen wir das zweite Viertel in Angriff. Irgendwie war uns ein bisschen die Lust auf Melone vergangen, und wir pickten uns nur die süßen Innenstücke heraus, den Rest warf ich unauffällig beim Spazierengehen in die Gegend. Ich brauchte zehn Spaziergänge dazu, und mich zwackte dabei ein ziemlich schlechtes Gewissen. Man wirft doch keine Lebensmittel weg, das hat mir meine Schwiegermutter eingebläut. Klar doch, die isst alles, auch wenn es schon halb vergammelt ist. Aber ICH NICHT!
Gut, die Hälfte war gegessen, beziehungsweise entsorgt. Ich wuchtete die übrig gebliebene Hälfte der Melone von der Waschküche auf meine Terrasse. Meine Schwester würde nämlich bald wieder da sein, und in der Waschküche hätte sie die verflixte Melone sehen können.
Ich versteckte sie auf der Terrasse unter alten Zeitungen. Sie sah in ihrem Müllbeutel immer noch prächtig aus, ihr zartrotes Fruchtfleisch wirkte immer noch sehr, na ja zartrot...
Ab und zu beim Abstauben schaute ich sie vorsichtig an. Und sie schaute vorwurfsvoll zurück. „Warum isst du mich nicht?“, schien sie zu fragen, jedenfalls bildete ich mir das ein. Und in meinem Kopf ertönte unangenehm das Stück 'Watermelone Man'.
Was sollte ich nur tun? Wegschmeißen konnte ich sie nicht, die Mülltonne wäre unter ihrem Gewicht glatt zusammengebrochen, und Garten und Gegend waren ja auch schon melonengesättigt. Also wartete ich... Aber auf was? Meine Schwester war mittlerweile wieder zu Hause, doch seltsamerweise fragte sie nicht, ob die Melone mir gemundet hätte.
Wirklich seltsam... Und dann kam’s mir. Ich erinnerte ich mich daran, dass ich die Melone schon bei ihr gesehen hatte, die musste uralt sein, älter als Methusalem. Klar doch, Schwesterherz hatte mich reingelegt, sie schmeißt nämlich auch nicht gerne was weg.
Das verdammte Stück 'Watermelone Man' dröhnte in meinem Kopf...
Ich verdrängte die Melone aus meinen Gedanken, nur durch Zufall warf ich ihr heute Morgen einen verlegenen Blick zu, und was soll ich sagen: Sie war im Begriff, sich aufzulösen. Das Fruchtfleisch fing an zu wässern und vergammelte anscheinend. Das war die Gelegenheit! Ich ergriff todesmutig den triefenden Riesenabfallbeutel, schleppte ihn vorsichtig ins Badezimmer und hielt ihn über die Kloschüssel. Dort wrang ich den Beutel regelrecht aus, während ich mir die Nase zuhielt, denn das Zeug stank wie die Pest. Nachdem der Saft ins Klo abgegangen war, konnte ich den Rest endlich in die Mülltonne entsorgen.
Triumphierend erklang die Melodie, aber ich hatte den Text ein wenig abgewandelt, nämlich zu seiner ursprünglichen Form, nämlich: 'WHAT A MELLOW MAN'. Das passte viel besser!
Als ich von der Mülltonne ins Haus zurückkehrte, traf ich meine Schwester. Gut gelaunt sagte sie zu mir: „Du magst doch Wassermelonen, Schatzi! Ich hab’ da noch eine liegen, und da ich morgen in Urlaub fahre...“
PS: Danke Herbie Hancock!
PS: Danke Schwesterchen, ich muss oft an dich denken, eigentlich immer, du warst der beste Teil von mir. Und als ich das geschrieben habe, da warst du noch so lebendig, und ich möchte dich lebendig erhalten!
Iggy - 22. Aug, 21:55